Der Gottesdienst
Solidaritätsbekundungen
Christliche Gottesdienste zeichnen sich durch vier Hauptteile aus. Dies sind die Haupteile eines jeden evangelischen bzw. katholischen Gottesdienstes und einer jeden Gemeindemesse:
1. Eröffnung und Anrufung
2. Verkündigung
3. Sakrament bzw. Solidaritätsbekundungen
4. Sendung und Segen
Wie die Gliederung christlicher Gottesdienst in vier Hauptteile zustande kommt, erkläre ich ausführlich unter Dynamik.
Abkündigungen, Kollekte (Dankopfer), Fürbitten mit Vaterunser
Zeichen der Solidarität mit den Leidenden
Wir beschreiben hier den Gemeindegottesdienst ohne Abendmahl (Eucharistie). Für diesen Wortgottesdienst ohne Sakrament fassen wir die ich die Elemente Abkündigungen, Dankopfer (Kollekte), Allgemeines Kirchengebet (Fürbitten) zu einem Hauptteil zusammen. Wir beschreiben sie hier unter der Überschrift Solidaritätsbekundungen.
Damit erhalten diese gottesdienstlichen Elemente keinen neuen Ort im Gottesdienst. Sie behalten ihre übliche Stelle im Rahmen des Gottesdienstablaufes. Sie erhalten aber ausdrücklich ein besonderes Gewicht - in der Hoffnung, damit anzuregen, dass sie als Block nicht so leicht übersehen werden, wenn ein Hauptteil zur besonderen Ausgestaltung und Entfaltung aussucht wird. Diese Teile dürfen nicht absinken als Rest vor dem Schluss.
Die Sehnsucht nach Gerechtigkeit in Worten und Taten als Hauptteil im Gottesdienst
Im Brief an die Galater zeigt der Apostel Paulus auf, das Christen sich auszeichnen durch Sehnsucht nach Gerechtigkeit und durch "Glaube, der durch Liebe tätig ist" (siehe Galater 5,5-6). "Der Nächste", den wir lieben sollen wie uns selbst (Galater 5,14), sitzt nicht nur neben uns im Gottesdienst. Wir erkennen ihn und sie an der Bedürftigkeit (mit der sie unsere tätige Liebe brauchen).
In diesem Teil des Gottesdienstes lassen wir nun unseren Blick schweifen, um die Kennzeichen der Bedürftigkeit zu entdecken und um an die Menschen, die uns brauchen, zu denken (Abkündigungen), für sie zu beten (Fürbitten) und mit ihnen zu teilen (Dankopfer).
Dieser Hauptteil ergibt sich aus der Verkündigung, und er ist ebenso wichtig wie diese. Er zeigt: Aus der Verkündigung erhalten wir Kraft und lassen uns durch sie auf den Weg bringen.
Solidarität verlangt nach gerechter Sprache
Zu der Sehnsucht nach Gerechtigkeit und Veränderung muss unsere Sprache im Einklang stehen - sie selbst muss gerecht sein. In der Wahl unserer Worte grenzen wir schnell Menschen aus, die in einzelnen Lebensbereichen oder grundsätzlich anders denken, handeln und leben. Wir fördern Vorurteile und nehmen Verurteilungen vor - ohne es zu wollen. Das geschieht selbst in unseren Gottesdiensten.
Die gutgemeinte und wichtige Suche nach „Bedürftigkeit“ führt leicht dazu, dass wir uns über die Menschen stellen, ihre Gaben nicht wahrnehmen und nicht erkennen, dass wir von ihnen lernen können und sollten. Auch in unseren gottesdienstlichen Abkündigungen, in unseren Gebeten, und auch in unserer Weise zu spenden wird oftmals Ausgrenzung und Überheblichkeit deutlich.
Denkschrift "Anregungen zu einer gerechten Sprache im Gottesdienst."
Solidarität fängt schon im Denken und in unserer Sprache an. Zur Konkretisierung hier Ausschnitte aus der Denkschrift "Anregungen zur gerechten Sprache im Gottesdienst" der Landessynode der Evangelischen Kirche von Westfalen (EKvW) von 1994:
Eine gerechte Sprache bezieht die Ausdrucksmöglichkeiten und Verstehensmöglichkeiten aller ein. (...) Der bewusste Gebrauch von Beispielen, die eine andere soziale Wirklichkeit aufzeigen (die Chefin, der Mann, der eine Angehörige pflegt, der Vater, der die Kinder erzieht), kann die traditionelle (Sprach-) Wirklichkeit verändern helfen. (...) Durch die Sprache unserer Gottesdienste entsteht oft der Eindruck, als könne Gemeinde nur eine Gemeinde der ‘Starken’ sein, der die ‘Schwachen’ gegenüberstehen. Gesellschaftlich wie kirchlich gelten als Maßstab für Stärke häufig Männlichkeit, Jugend, Erfolg im Beruf, Vollbesitz geistiger und körperlicher Kräfte, Aufbau einer Familie. Daraus entsteht die Frage, ob die ‘Schwachen’ nur mit ihren Defiziten wahrzunehmen sind oder auch als „neue Kreatur“ (2 Korinther 5,17) mit Gaben, Fähigkeiten und der alltäglichen Möglichkeit, befreiende Lebenserfahrungen zu machen.
Weiter: Abkündigung II
Unsere Veröffentlichungen zur Planung und Gestaltung von Gottesdiensten und Andachten
Für mehr Infos Bücher anklicken
Liebe wird sein. Liebe, was sonst?
Das kleine Buch "Liebe wird sein, Liebe, was sonst?" ist ein besonderer Erfolg. Es liegt nun in 8. Auflage vor (Stand Frühjahr 2023). Kleine Geschichten und Gedichte wechseln sich ab. In den Geschichten begegnen Menschen in Trauer, mit Verlusterfahrungen und mit der Frage "Was wird nach diesem Leben sein?" der Alten Weisen Frau bzw. dem Ewig Kleinen Prinzen. Die Gedichte sind Besinnungen über Liebe, Verlust, Tod und Ewigkeit.
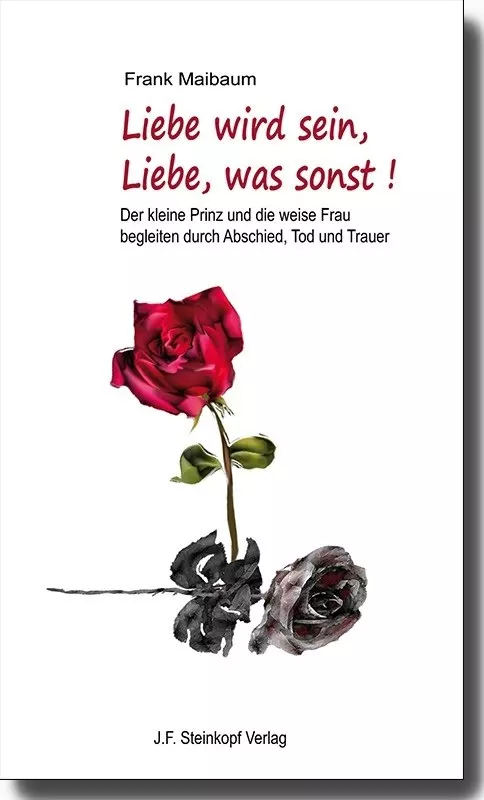
Ich ruf dir meine Liebe zu, ein Dankeschön und ein Verzeih!
Die Geschichten, Gedichte und Besinnungstexte in "Ich ruf dir meine Liebe zu, ein Dankeschön und ein Verzeih!" sind "Worte über die Grenze von Leben und Tod hinweg". So entsteht ein Dialog zwischen einem Menschen im Hier und Jetzt und einer verstorbenen Person. Wechselseitig bedankt man sich, verzeiht und versichert sich der bleibenden Liebe.
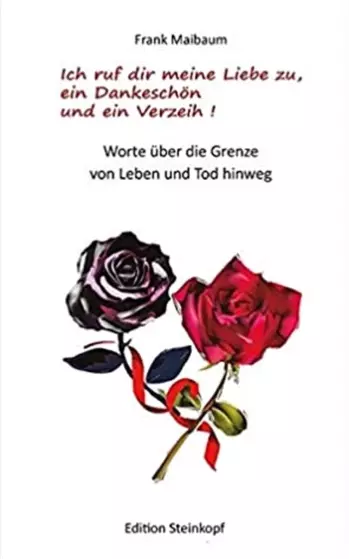
DAS ABSCHIEDSBUCH
"Das Abschiedsbuch" von Frank Maibaum ist der Klassiker unter den Ratgebern zur Gestaltung einer Trauerfeier. Es erklärt jeden Abschnitt der Trauerfeier, gibt Anregungen zur Gestaltung und enthält zahlreiche Texte für religiöse und weltliche Lesungen. Im Jahr 2021 erschien die fünfte überarbeitete Auflage.
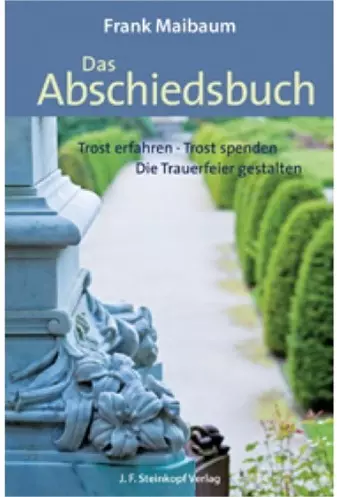
DAS TAUFBUCH
"Das Taufbuch" von Frank Maibaum ist der Klassiker unter den Ratgebern zur Gestaltung einer Taufe. Es erklärt jeden Abschnitt des Taufgottesdienstes, gibt Anregungen zur Gestaltung und enthält zahlreiche Texte für religiöse und weltliche Lesungen. Das Taufbuch ist nun in sechster überarbeiteter Auflage im Buchhandel erhältlich.
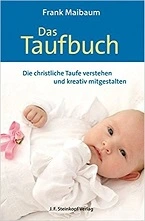
DAS TRAUBUCH
"Das Traubuch" des Pfarrers und Erziehungswissenschaftlers Frank Maibaum und der Theologin Verena Schmidt ist der Klassiker unter den Ratgebern zur Gestaltung einer kirchlichen, standesamtlichen und freien Trauung. Es erklärt jeden Abschnitt des Hochzeitsgottesdienstes, gibt Anregungen zur Gestaltung und enthält zahlreiche Texte für religiöse und weltliche Lesungen. Das Traubuch ist als 7. komplett erneuerte Auflage im Buchhandel erhältlich.
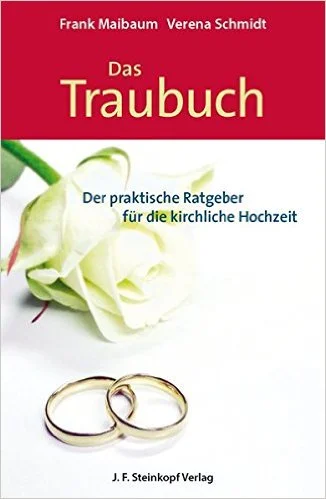
DAS GOTTESDIENSTBUCH
Das Gottesdienstbuch von Frank Maibaum erschien in erster Auflage noch vor dem großen offiziellen Evangelischen Gottesdienstbuch. Auf 120 Seiten beschäftigt es sich mit jedem Element des evangelischen Gottesdienstes, erklärt Bedeutung, gibt Texte, Anregungen zur Gestaltung und nennt Alternativen. Es ist ein Leitfaden für die gemeinsame Gottesdienstgestaltung - hochgelobt von Geistlichen und den Menschen, die sich an der Gottesdienstgestaltung beteiligen. Es liegt in zweiter überarbeiteter Auflage vor.
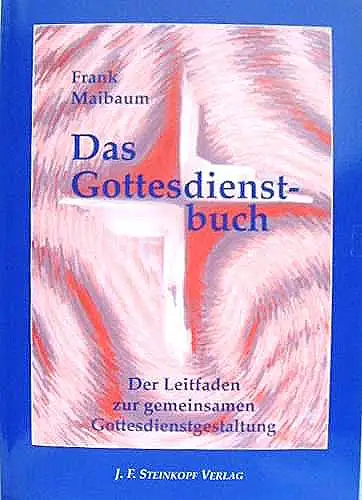
Ja - Weil ich dich liebe!
"Ja - weil ich dich liebe !" ist ein kleines Buch (120 Seiten) mit Lesetexten zur Gestaltung der Trauzeremonie - insbesondere der kirchlichen Trauung, aber auch der standesamtlichen sowie freien Trauung. Es enthält: Trauversprechen/Treuegelöbnisse, Liebeserklärungen, Texte zum Ringwechsel, Texte zur Hochzeitskerze, Fürbitten, Liebe Wünsche, Segenswünsche, biblische Lesungen, Weisheiten über die Liebe, die 40 beliebtesten Trausprüche, Begrüßungen zum Hochzeitsempfang und Texte zum Anschnitt der Hochzeitstorte.
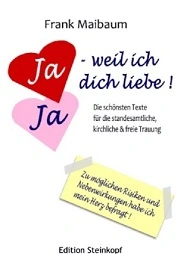
Weiter:
Abkündigung II